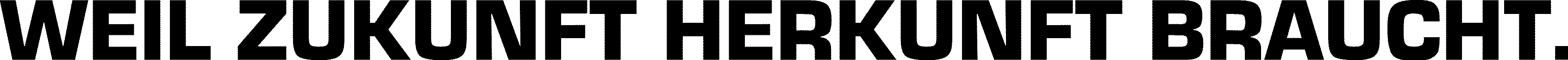BAURECHT IN DER ALTSTADT ALS STEUERINSTRUMENT
BEBAUUNGSPLÄNE, BAULEITSATZUNGEN
Das Bauen hat unsere Welt geformt, wie fast keine andere Entwicklung des Menschen. Noch heute sind die größten und über sich hinaus wirksamsten Projekte die wir kennen nicht selten Bauprojekte bei denen Gebäude oder Bauwerke mit viel öffentlichem Interesse entstehen. Dazu bedarf es noch nicht einmal einer großstädtischen Situation. Auch ein Rathaus, eine Kirche oder ein neues Feuerwehrhaus in einer Kleinstadt muss im Maße der hier vorherrschenden Verhältnisse als großes Projekt verstanden werden. Für einen maßstäblich kleineren Haushalt sind schon Investitionen große Sprünge, die anderen, größeren Institutionen nicht einmal ein Gespräch wert wären. Das Erkennen dieser im Maße der vorherrschenden Verhältnisse, ist die Grundvorrausetzung für das Anerkennen beider als strukturell Gleichwertige.
Das Baugesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland (BauGB) geht in seiner grundlegenden inneren Organisation von einem in sich funktionierenden, also ordnungsgemäßen, baurechtlichen Zustand aus. Dass dies auf Grund gewachsener und historischer Zustände und nicht zuletzt auch durch das Anwenden anderer Rechte, wie beispielsweise dem Erbschaftsrecht, nicht immer der reale Fall vor Ort ist, muss nicht gesonderte Erklärung finden. Genau betrachtet ist das bei fast jedem Recht so. Es bildet stets lediglich die Grundlage einer damit konformen, genaueren Lösung, die es zu erarbeiten gilt.
Besonders im städtebaulichen Bereich, geht das Baugesetzbuch von wenigen unterschiedlichen möglichen Situationen aus und trifft recht richtungsweisede Regelungen. Diese Regularien entspringen jedoch der Vorstellung von der geplanten Stadt, als homogen durchorganisierter Ablaufraum des Alltags. Die Stadt als ‚Planung’, in der alle Bedürfnisse und Anforderungen ihren ureigenen Ort finden und ihren eigenen begrenzten Bereich haben, der optimal auf diese Nutzungsanforderungen vorbereitet ist, ist jedoch eine Idee, die erst durch die Industrialisierung in unserer heutigen Vorstellung aufkommt und sich auch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts endgültig durchsetzt, als die steigende Mobilität die Differenzierung von Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort erst ermöglicht. Zuvor waren die Stadtkörper Mischgebilde aller verschiedenen Nutzungen – und zwar bunt durcheinander.
Die Differenzierung der Nutzungen wurde erstmalig möglich, als sich so etwas wie Bürgertum als eigenständige und von der Obrigkeit emanzipierte Gesellschaftsschicht entwickelte. Erst als man einzelne erforderliche Dinge aus dem Stadtkörper ausgliedern konnte und sie gegen Entlohnung von anderen, vor der Stadt erbringen lassen konnte, war es schlicht und ergreifend nicht mehr erforderlich sie selbst zu tun. Das ‚Ein-Raum-Haus’, in dem sowohl Wohnen, Arbeiten aber auch Tierhaltung und handwerkliche Arbeit stattfindet, wird zum Wohn-Haus, in dem in aller Regel die Funktionsbereiche eigene, voneinander abgeschlossene Bereiche bekommen oder ganz wegfallen.
Reine Wohnquartiere, in denen ausschließlich nur gewohnt wurde, wie wir das heute kennen, gab es auf Grund der erforderlichen Bedingungen nie. Die Bedingungen waren banale Dinge des Alltags wie eine möglichst wirtschaftliche ( – also kurze – ) Erreichbarkeit aller Alltagsdinge, wie (Eigen-) Versorgung oder wie Bedarf nach etwas Exklusivem. Erst als man, weit vor der damaligen Stadt, die dampfende, stinkende und Platz einfordernde Verbindung in die ferne Welt einrichtete, begann für viele Städte und Dörfer der Aufbruch in einer neue Zeit der baulichen Organisation. Zuvor waren sie darauf angewiesen alles Bauliche aus den vor Ort zur Verfügung stehenden Ressourcen herzustellen. In Wäldern baute man vorzugsweise Holzhäuser. In kargen Gegenden eher Steinhäuser. In Feld-Landschaften wurde vorzugweise Viehzucht betrieben. Und in Steil-Lagen eher Weinbau, denn Landwirtschaft.
Daraus erklärt wird schnell ersichtlich, warum wir es bei Altstadtquartieren nie mit homogenen Siedlungsstrukturen zu tun haben können. Diese Teile eines Stadtkörpers müssen, aus der Geschichte heraus, sogenannte Mischgebiete sein, denn sie sind die oben erwähnten angestammten Flächen, in denen schon vor dieser Entwicklung eine erforderliche Infrastruktur vorhanden war. Sie sind der existentielle Ausgangspunkt der Vorstellung einer modernen Stadt. Ihre ganze Existenzstruktur baut darauf auf ein Mischgebiet zu sein, weil sie aus früheren Gesellschaften stammen, die eine großflächige Teilung nach festgelegten Nutzungen gar nicht als erforderlich erachten konnte. Dieses Denken entspringt erst unserer Tage als Industriegesellschaft, die alle Vorzüge der Moderne kennt und nutzt.
Und so verwundert es nicht, dass die meiste Altstadtquartiere heute durch keinerlei Planungsrecht in Form eines Bebauungs- oder Nutzungsplanes beplant sind. Es gibt dort defacto keine ordnungsrechtlichen Festlegungen zur Art und Ausmaß einer baulichen Nutzung. Als man in einer postmodernen Denkweise begann, die neuen Teile von Städten nach Funktionen getrennt zu planen und sich Gedanken darüber zu machen, wer wo was wie bauen darf, waren diese Stadtteile schon längst da uns funktionierten in sich auch einigermaßen. Natürlich hatten sie Vorzüge und Nachteile. Aber das waren die kleinen Lebensgeschichten des Alltages, die das Leben an einem Ort, von dem man zumeist nicht all’ zu oft weg kam, füllten.
Für den Sanierungsplaner ist das Erarbeiten eines gelungenen Sanierungszieles mit den zahllosen und unterschiedlichen Akteuren aus Bevölkerung und Verwaltung aus allen Ebenen oft schon schwer genug. Noch fordernder wird dann die Durchführung solcher Planungen ohne ordentliche bauordnungsrechtliche Grundlage. Der schon beschriebene Paragraph 35 des Baugesetzbuches trifft zwar Reglungen für unbeplante Innenbereiche einer Gemeinde, diese sind jedoch bei weitem nicht detailliert genug zur Durchsetzung einer individuellen Stadtsanierung. Und das können und sollen sie ja auch gar nicht sein (vgl. insoweit Teil 2).
Einfacher scheint es Instrumente zu wählen die schneller und feinteiliger formal von denen angepasst werden können, die vor Ort sind und die Gegebenheiten kennen. Eine „Sanierungssatzung“ oder eine „Altstadtsatzung“ beispielsweise sollte zum Ziel haben individuelle Maßnahmen und Planungen, gezielt zur Durchführung eines Sanierungszieles steuern zu können. Es gibt da allerdings nur einen schmalen Grad auf dem man sich bewegen kann. „Gestaltungssatzungen“ wie beispielsweise Farbleitpläne sind schon kritischer zu betrachten, denn sie greifen direkt in die Entfaltungsrechte der Bürger ein und beschränken diese.
Gestaltungen können aber wichtige Rollen in der Altstadtsanierung spielen, wenn eine Stadt sich im Zuge eines bestimmten Stadtmarketings in einer besonderen Gestalt präsentieren möchte. So hat beispielsweise die Stadt Potsdam für ihre Altstadt eine Gestaltungssatzung erlassen, die der Erscheinung der Stadt im Bild des 18. Jahrhunderts Rechnung trägt, ohne die Menschen tiefgreifender einzuschränken. Man stelle sich nur vor, wenn mitten in dieser barocken Pracht mit all’ den Baudenkmälern ein kahler Funktionsbau emporrage würde.
Nicht alleine die Kompetenzen in den Bereichen der Durchführung sind es, die eine Kommune selbst einfach gar nicht abbilden kann, es sind auch die bereits ausführlich erwähnten vielen kleinen und großen Vorbereitungen solcher Projekte, zu deren erfolgreichen Bearbeitung es Erfahrungswerte braucht. Eine Kommune, die eine Stadtsanierung angehen möchte, tut dies außerhalb ihres gewöhnlichen Aufgabenfeldes der Verwaltung. Viel mehr ist eine solche Stadtsanierung eine zusätzliche Aufgabe für eine kommunale Verwaltung. Demnach sind in den meisten kleineren bis mittleren Kommunen weder die Stellen noch die Mittel für Stellen zur Verfügung, um diese Fachkompetenzen selbst bilden zu können. So haben sich verschiedene Modelle teilöffentlicher oder privatwirtschaftlicher Unternehmen gebildet, die sich auf die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Stadtsanierungen spezialisiert haben. Einen Projektpartner mit Facherfahrung zu haben, ist für Kommunen in jedem Fall angenehmer und einfacher umsetzbar, als auf verwaltungsrechtlichem Wege, neue Stellen oder gar ganze Aufgabenbereiche in einer Verwaltung aufzubauen.